Warum hohe Staatsdefizite nicht automatisch zu bärischen Märkten führen – und was Anleger daraus lernen können!
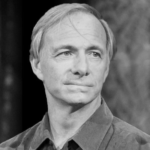
Ray Dalio – founder of Bridgewater Associates, Quelle:x.com
Die entscheidende Frage lautet nicht, wie hoch die Verschuldung ist – sondern wofür das Geld ausgegeben wird!
Die Panik vor hohen Staatsdefiziten ist zurück.
Und mit ihr die alte Leier: Zu viel Schulden führen zu Inflation, Währungsverfall und am Ende zum Zusammenbruch.
Doch beruht diese vermeintliche Gewissheit nur auf einem fundamentalen Missverständnis darüber, wie moderne Währungssysteme funktionieren?!
Die entscheidende Frage für Anleger lautet nicht: Wie hoch ist die Staatsschuldenquote?
Sondern: Wofür wird das geliehene Geld verwendet?
Fließt es in produktive Investitionen — oder verschwindet es in Spekulation und Konsum?
Der Unterschied zwischen produktiven und unproduktiven Schulden
Die Geschichte liefert eindeutige Belege: USA 1945–1975, Japan 1950–1990, China 2000–2020.
In allen Fällen führten hohe Staatsschulden zu jahrzehntelangem Boom, weil das Geld in reale Kapazität floss.
Die wirklich toxische Konstellation sieht anders aus: Hohe Defizite bei gleichzeitig stagnierender oder sinkender Produktivität, kombiniert mit Kapital, das ausschließlich in bestehende Assets rotiert.
Wenn Geld nicht mehr in Fabriken fließt, sondern nur noch in Finanzinstrumente — dann wird aus Leverage tatsächlich ein Ponzi-Schema.
Dann kommen die Populisten, dann entsteht Inflation, dann zerbricht der soziale Zusammenhalt.
Die aktuelle Debatte zwischen Ray Dalio und Tominaga illustriert genau diesen Punkt
Ray Dalio hat kürzlich erneut vor dem klassischen Imperien-Untergang durch exzessive Verschuldung gewarnt.
Seine These folgt dem vertrauten Muster:
Zu viele Schulden führen unweigerlich in eine selbstverstärkende Abwärtsspirale aus Währungsverfall, sinkenden Lebensstandards und politischem Extremismus.
History shows us that having too much debt during an economic downturn leads to a classic, self-reinforcing cycle where:
1) The empire can no longer borrow the money to repay its debts
2) It prints a lot of new money, which devalues the currency and raises inflation
3) Living…— Ray Dalio (@RayDalio) November 6, 2025
![]()
S Tominaga (@CsTominaga) lieferte daraufhin eine der schärfsten Gegenreden, die in dieser Debatte bisher zu lesen war. Seine Antwort entlarvt aus seiner Sicht fundamentale Missverständnisse über moderne Währungssysteme, die Dalios Argumentation zugrunde liegen.
You still don’t get it, Ray. History doesn’t “show” what you think it does—it shows the same misunderstanding repeated by financiers who never learned what money is. Governments don’t “print money” to pay debts; they issue debt. The new bonds aren’t creation ex nihilo—they’re…
— S Tominaga (@CsTominaga) November 7, 2025
Dalio beschreibt das Symptom — Populismus, Inflation, soziale Unruhe — identifiziert aus Tominagas Sicht aber nicht die wahre Ursache. Diese liege im Verfall der realen Produktionsbasis bei gleichzeitiger Finanzialisierung der Wirtschaft.
Tominagas Analyse:
Die Geschichte bestraft nicht die Verschuldeten. Sie bestraft die Unproduktiven.
Die fünf entscheidenden Argumente Tominagas:
1. Staaten mit eigener Währung können immer zahlen
Die Behauptung, ein Staat könne „nicht mehr borgen“, ist schlicht falsch. Die USA refinanzieren ihre Schulden seit 1790 kontinuierlich, das Britische Empire finanzierte jahrhundertelang Kriege mit perpetual bonds — selbst unter Goldstandard. Solange die Schulden in eigener Währung denominiert sind, existiert technisch keine Möglichkeit eines Zahlungsausfalls.
2. „Geld drucken“ ist ein populistischer Mythos
Es entsteht kein neues Nettovermögen für den Privatsektor, sondern lediglich eine Maturity-Transformation.
Inflation entsteht nicht durch diese Bilanzverschiebung, sondern ausschließlich dann, wenn die reale Produktionskapazität nicht mit der nominalen Nachfrage mitwächst.
3. Inflation wird durch zu wenig Produktion bei zu viel nominaler Nachfrage erzeugt
Weimar erlebte Hyperinflation, weil die Produktionsbasis durch Reparationen und Besatzung zerstört wurde. Zimbabwe vernichtete seine Landwirtschaft durch Enteignungen. Japan hingegen trägt heute eine Schuldenquote von über 260% — ohne jede Hyperinflation, denn die Schulden finanzierten produktive Investitionen in Infrastruktur und Industrie.
4. UK 1945: über 250% Schuldenquote, Rationierung – und dann 30 Jahre Golden Age
Großbritannien beendete den Zweiten Weltkrieg mit einer Schuldenquote von über 250% und strengster Rationierung. Die Schulden finanzierten jedoch den systematischen Wiederaufbau. Das Ergebnis: 30 Jahre Wachstum, steigende Reallöhne und soziale Stabilität. Der britische Nachkriegsboom war keine Ausnahme, sondern die logische Folge produktiver Kapitalverwendung.
5. Die wahre Gefahr: Wenn Kapital in Spekulation statt in Produktion fließt
„Productivity collapses when speculation replaces production. When capital chases yield in financial instruments rather than in factories, the multiplier dies.“ Wall Street hat genau dieses Modell perfektioniert: Private-Equity-Rollups, Aktienrückkäufe, Immobilienspekulation, Krypto-Casinos — alles ohne realen Output. Das ist der eigentliche Krebs im System, nicht die Staatsanleihe.
Was bedeutet das konkret für Ihr Portfolio?
Sollten Sie Tominagas Thesen folgen, dann ist die Debt-to-GDP-Zahl nicht die Kennzahl, die Sie beobachten sollten. Stattdessen kommt es auf drei andere Faktoren an:
Total Factor Productivity (TFP): Steigt die Produktivität der Volkswirtschaft? Werden neue Technologien entwickelt und skaliert? Wenn ja, können auch hohe Defizite problemlos getragen werden — und sind sogar wachstumsfördernd.
Anteil der Unternehmensinvestitionen (Capex) am BIP: Investieren Unternehmen in reale Produktionskapazität? Oder verschwinden die Gewinne in Aktienrückkäufen und Dividenden? Nur bei steigendem Capex entsteht echtes Wachstum.
Verwendung der Staatsausgaben: Fließt das Geld in realen Kapitalstock — Infrastruktur, Forschung, Bildung? Oder verschwindet es in Transferzahlungen und Bailouts für unproduktive Branchen?
Wer heute in Unternehmen investiert, die echte Produktivität schaffen — Halbleiter, Energie, Robotik, Logistik, Biotechnologie — wird Tominaga nach auch in einem Umfeld hoher Staatsverschuldung sehr gut positioniert sein.
Denn diese Unternehmen profitieren direkt von staatlichen Investitionsprogrammen und erweitern die reale Produktionskapazität der Wirtschaft.
Die wirklich gefährliche Konstellation entsteht dort, wo hohe Defizite auf stagnierende Produktivität treffen. Wer ausschließlich in bereits aufgeblähte Asset-Klassen investiert (Immobilien in überhitzten Märkten, Tech-Aktien ohne echten Cashflow, spekulative Krypto-Projekte) wird genau dann verlieren, wenn die Musik aufhört zu spielen.
Fazit: Wofür wird das Geld ausgegeben?
Die entscheidende Frage für Anleger lautet nach Tominaga also nicht, ob die Staatsschulden steigen.
Sie lautet: Wofür wird das Geld verwendet?
Investitionen in Produktivkapital schaffen langfristiges Wachstum und machen hohe Defizite tragbar. Geld, das in Spekulation und unproduktive Branchen fließt, führt dagegen tatsächlich in die Krise.
Wer diesen Unterschied versteht, wird nicht in Panik verfallen, wenn die Schuldenstände steigen.
Stattdessen richtet sich der Blick auf die wirklich relevanten Kennzahlen:
Produktivitätswachstum, Investitionsquote und die Qualität der Staatsausgaben. Dort liegt die Antwort darauf, ob die aktuellen Defizite Grundlage für den nächsten Boom sind — oder für den nächsten Crash.
Disclaimer & Risikohinweis
Die bereitgestellten Informationen und Materialien dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Sie ersetzen nicht die individuelle Beratung durch einen qualifizierten Finanzberater. Leser sollten eigenverantwortlich handeln und sich umfassend informieren, insbesondere durch die Lektüre relevanter Börsenprospekte und anderer offizieller Dokumente. Für weiterführende Informationen wird empfohlen, die jeweilige Webseite des Herausgebers zu konsultieren. Der Autor übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Inhalte entstehen.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte: Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein. Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen diese Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen erstellt. Veröffentlichungen, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung dar und können nicht als solche ausgelegt werden. Der Autor haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Investitionen in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Totalverlusts des eingesetzten Kapitals. Leser sollten sich der Risiken bewusst sein und vor Investitionsentscheidungen eine unabhängige und professionelle Beratung in Anspruch nehmen.
Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Die dargestellten Informationen können durch aktuelle Entwicklungen überholt sein. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte übernommen.
Für weiterführende Informationen wird empfohlen, die jeweilige Webseite des Herausgebers zu konsultieren.
Themen im Artikel





